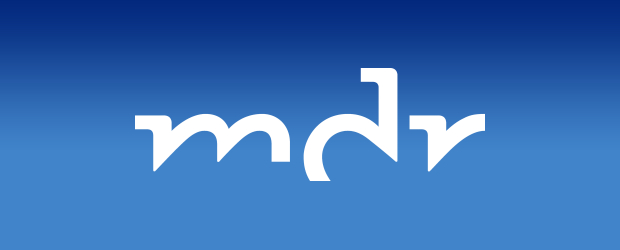Woran machen Sie das Verblassen fest?
Der Recherche-Aufwand, den meine Kollegen und ich bei jeder "Quarks"-Sendung investieren, ist sehr hoch. Eine 45-Minuten-Sendung, wie wir sie machen, bedeutet viel inhaltliche Arbeit und Vorbereitung. Das ist sehr wichtig, scheint aber nicht überall so zu sein. Manche fragen, wieso sie sich mehr Mühe geben sollen, wenn man auch mit einfacheren Mitteln eine durchaus ordentliche Zahl an Zuschauern erreichen kann.
Wie lautet Ihre Antwort?
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Medien nach wie vor die Funktion der Aufklärung haben. Es geht im deutschen Fernsehen zu oft nur noch darum, Programme einfach nur zu füllen. Als ich anfing, ging das Fernsehen noch schlafen, irgendwann war Sendeschluss. Heute gibt es rund um die Uhr Programm. Die Balance zwischen Sendeplätzen und dem Generieren von Inhalten befindet sich momentan in einer Schieflage. Im Internet ist das noch schlimmer.
Raubt Ihnen das mitunter auch den Spaß am Fernsehen?
Ich bin von Herzen ein Vertreter der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit der Idee eines Journalismus, der nicht auf Kommerz angewiesen und eine unabhängige Macht im Staate ist. Das sage ich auch meinen Kollegen immer wieder: Ihr müsst nicht den Privaten nacheifern. Macht es anders und seid stolz darauf.
Wenn die Öffentlich-Rechtlichen die Privaten kopieren, dann tun sie das ohnehin oft schlecht. Sie können andere Sachen viel besser.
Es ist meine Hoffnung, dass die öffentlich-rechtlichen Sender in den nächsten Jahren stärker zu ihrem Auftrag zurückfinden. Ich stelle zunehmend fest, dass die Menschen ein Bedürfnis nach guter Information haben. Sie wollen nicht nur mit Privatfernsehen zugeballert werden. Im Hörfunk ist die öffentlich-rechtliche Haltung übrigens viel stärker ausgeprägt als im Fernsehen. Oder schauen Sie sich die Printmedien an, die zunehmend in einen kommerziellen Druck geraten. Und das ist noch nicht das Ende. Kürzlich klopfte die "Huffington Post" bei mir an. Die wollen sich die Sahne von oben nehmen und verlangen, dass man umsonst schreiben soll. Dieses Businessmodell muss man nicht unterstützen. Denn letztlich resultiert daraus der Kollateralschaden, dass die anderen Blätter noch stärker unter Druck geraten. Da mache ich nicht mit.
Lässt sich dieser Trend noch stoppen?
In erster Linie sehe ich die Öffentlich-Rechtlichen in der Pflicht. Sie müssen sich bewusst machen, dass sie eine andere Aufgabe haben als die Privaten. Da geht es um Werbezeiten, Quote und Zielpublikum. Journalismus hat aber mit diesen Kriterien überhaupt nichts zu tun. Das Internet kann das nicht ersetzen, weil es sehr fragmentiert ist. Das führt auf Dauer dazu, dass Inseln von Interessensgruppen entstehen, die nebeneinander leben. Gesellschaft aber lebt von der Reibung, den Widersprüchen, den Kompromissen. Das kann das Fernsehen besser.
Aber es gibt doch Hoffnung. Ihre Sendung erreichte zuletzt 1,2 Millionen Zuschauer. Das ist eine sehr respektable Zahl.
Wahrscheinlich waren es mehr. Interessant ist doch, dass wir mehrere hunderttausend Zuschauer haben, die wir über einen anderen Weg erreichen.
Wie wichtig ist die Quote für Sie?
Auf die Quote haben wir noch nie geschaut. Ich behaupte, dass man das sogar merkt. Uns geht es um ein Thema – und wenn ein Thema wichtig ist, machen wir es. Wenn Sie gegen ein Fußballspiel aus einem Dritten Programm heraus immer noch mehr als eine Million Zuschauer erreichen, dann hat man nach 20 Jahren vermutlich nicht so viel verkehrt gemacht.
Viele schalten vermutlich auch aus Gewohnheit ein.
Der Zuschauer – wenn es ihn denn gibt – weiß bei uns, wo er dran ist. Er kennt im Laufe der Zeit unsere Haltung.
Kann man aus wissenschaftlicher Perspektive eigentlich sagen, wer "der Zuschauer" ist?
Nein. Aber man bekommt mit der Zeit ein Gespür dafür, wo man ansetzen muss. Man sollte immer Respekt vor den Personen haben, denen man etwas erklärt. Hochnäsigkeit nach dem Motto "Ich weiß mehr als du" ist absolut fehl am Platze. Der Zuschauer ist nicht dumm, und wir müssen ihn ernst nehmen.



 von
von