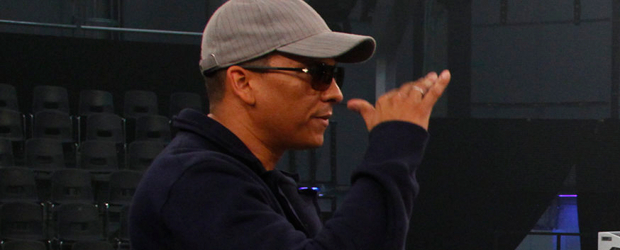Jetzt sprachen wir über „The Voice“ und „Ich liebe Deutschland“, zwei interessante Formate. Im vergangenen Jahr war Schwartzkopff TV aber auch für „Das Medium“ von RTL verantwortlich. Mal im Ernst: War das gutes Fernsehen?
Dass Sie das nicht gemocht haben, konnte ich ja auf DWDL lesen. Aber ich habe die Sendung sehr gemocht. Glauben Sie mir, vor der Produktion war ich auch sehr skeptisch. Eine Sendung, die Kontakt zu Toten aufnimmt? Kim-Ann Jannes, unser Medium, wusste plötzlich Dinge über unsere Protagonisten, die der Redaktion völlig unbekannt waren. Dann fängt einen der Zauber und plötzlich geht das nicht mehr: nicht dran zu glauben. Egal: Das Medium hat Menschen in Ihrer Trauer geholfen, sie getröstet und entlastet. Das hat mich einfach sehr berührt.
Aber abgesehen von der Frage, ob man überhaupt daran glaubt, mit Toten in Kontakt treten zu können, hat sich das Privatfernsehen in den vergangenen Jahren doch jeden Vertrauensvorschuss verspielt. Hat man sich mit Scripted Reality die Chance auf Glaubwürdigkeit bei anderen Formaten verspielt?
„Das Medium“ war vielleicht für manchen unglaublich, andere fanden es toll. Ich glaube sowieso, dass die Sehgewohnheiten immer weiter auseinander gehen. Den Muster-Zuschauer gab es ja sowieso nie und wir erleben, dass es einen großen Teil des TV-Publikums nicht interessiert, ob eine Geschichte echt ist oder dramaturgisch verdichtet wurde, damit sie so an Spannung oder Attraktivität gewinnt. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch das Publikum, dass aufmerksamer als je zuvor verfolgt, was erzählt wird.
Aber kommt das Fernsehen noch einmal raus aus der Preisspirale, die sich immer weiter nach unten dreht und somit Billigstformate fördert?
Die Frage ist doch: Kann sich die Auffassung durchsetzen, dass man Produktionen nur mit einem Preisschild versieht oder muss man nicht vielmehr auch Anreize schaffen? Stoffentwicklung und Pilotierung muss auch den Sendern etwas wert sein. Es hat doch einen Grund, warum kaum ein deutsches Format international Erfolg hat. Andere Länder fördern Kreativität und lassen Raum für Risiko und Entwicklung. Aber ein deutsches Format, das global erfolgreich ist? Fehlanzeige. Warum?
Stimmt. Ihre Erklärung?
Den Produzenten fehlt die Luft zum Atmen. Von uns wird Kreativität erwartet, aber nur die direkte Herstellung der Produktion bezahlt. Entwicklungskosten – je nach Produkt auch schnell mal sechstellig - kennen die Sender meist nicht. Da bleibt zu wenig Luft, um sich mit Ideen und Konzepten lang genug zu beschäftigen, um auch einmal einen deutschen Hit von internationalem Rang zu schaffen. Nehmen Sie „Schlag den Raab“, „Clever“ oder „Schillerstraße“ - ja, die wurden international verkauft. Aber nennt man sie in einem Atemzug mit Idol oder X-Factor? Nein. In so einer Situation kann man deutschen Produzenten nicht vorwerfen, wenn sie internationale Formate adaptieren - weil das den Sendern viel einfacher zu verkaufen ist: Dies bedarf keiner kostspieligen Entwicklung und das Risiko scheint durch den internationalen Erfolg begrenzter. Wer nach mehr Kreativität im deutschen Fernsehen ruft, der muss dann auch mal bei den Sendern anklopfen.
Herr Roeder, herzlichen Dank für das Gespräch.



 von
von