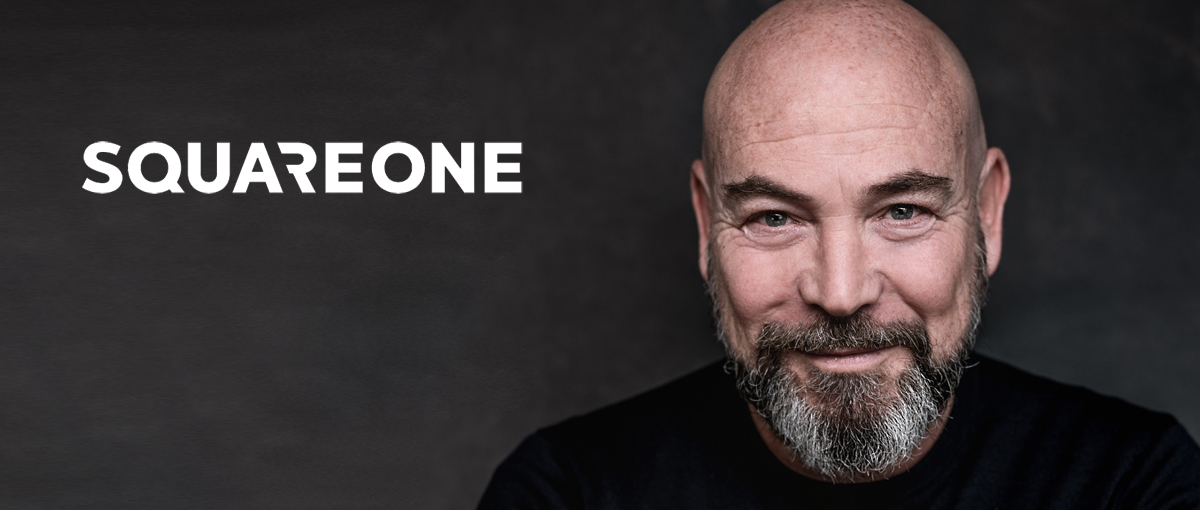© DWDL.de
© DWDL.deVor knapp zwei Jahren haben die Öffentlich-Rechtlichen die ARD & ZDF Fernsehwerbung GmbH gegründet. Dort werden allerdings lediglich die Vertriebsaktivitäten gebündelt. Die Vermarktung selbst macht nach wie vor jeder für sich. Bei der ARD, die sich aus derzeit neun Landesrundfunkanstalten zusammensetzt, kümmert sich – wie könnte es anders sein – auch in Sachen Werbung eine Arbeitsgemeinschaft um das Geschäft. So unterhalten die jeweiligen Häuser eigene Werbegesellschaften – zum Beispiel die WDR Mediagroup. Diese Töchter nun haben sich in der ARD-Werbung zusammengeschlossen. Seit 1994 unterhält diese Werbe-Arbeitsgemeinschaft die gemeinsame Vermarktungsgesellschaft ARD-Werbung Sales & Services. Beim ZDF hingegen ist auch die Vermarktung zentralisiert. Mittlerweile findet der Werbezeitenverkauf über die Tochter-GmbH ZDF-Werbefernsehen statt.
Dieses Unternehmen ist auch so etwas wie der Arbeitgeber der Mainzelmännchen. Jene Zeichentrickfiguren, die seit den ersten Sendertagen zwischen den Werbespots ihr Unwesen treiben. Die bunten Wichte mit den quäkenden Stimmen erfüllen gleich mehrere Zwecke in der Vermarktung: Jeder Spot bekommt eine isolierte Position, die kurzen Filme stellen Manövriermasse je nach Auslastung des jeweiligen Blocks dar und zudem ermuntern die lustig gemeinten Geschichten zum Dranbleiben.
Auch in den Vorabendprogrammen der ARD, die zum Teil regional vermarktet werden, kommen immer noch Zeichentrickfilmchen als Werbetrenner zum Einsatz. "Leo und Leo" – aus denen später der "Bayrische Löwe" wurde – begleiten die Werbung in Deutschland seit ihren Anfängen im Jahr 1956. Die Löwen stammen wie auch die legendären Mainzelmännchen aus der Feder von Karikaturist und Werbearchitekt Wolf Gerlach. Auch das Trio "Ute, Schnute, Kasimir", das zwischen 1978 und 1989 im Vorabend des WDR herumalberte, geht auf Gerlach zurück.
Nach wie vor ist unter anderem auch "Onkel Otto" im Einsatz - ein Fern-Seh-Hund, der als Maskottchen des Hessischen Rundfunks fungiert. Auch das schwäbelnde Duo Äffle und Pferdle des heutigen SWR schiebt immer noch Dienst während der Werbeblöcke. In diesem Jahr wurde anlässlich eines Festivals der erste Clip in 3D-Optik präsentiert.
Bevor Mitte der Achtziger Jahre RTL und Sat.1 auf den deutschen Markt drängten, waren die verfügbaren Werbezeiten noch heiß umkämpft. Doch bis es soweit war, musste Überzeugungsarbeit geleistet werden. Erst im Herbst 1965 – nach zweieinhalb Jahren Sendebetrieb – waren die Blöcke beim ZDF ausgelastet. Regelmäßig zu einem festen Termin im Herbst konnten die Werbezeiten geordert werden. "Anbuchung" nannte sich das Verfahren, das sich bis in die Neunziger Jahre auch bei den privaten Sendern noch halten konnte und bei dem fast die gesamten Werbedeals für das kommende Jahr festgezurrt wurden. Die Pioniere des Privatfernsehens erinnern sich noch heute mit leuchtenden Augen an das Verfahren, das einmal im Jahr für ordentlich Stress sorgte, das aber auch Sicherheit für die kommenden zwölft Monate gab.
"Wünsche zur Ausstrahlung im zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Rahmenprogramm oder die Bevorzugung bestimmter Werbeblöcke können nicht erfüllt werden", heißt es noch in den frühen Neunziger Jahren in einer Info-Broschüre des ZDF. In den Unternehmen hätten die Korken geknallt, wenn man einen Spot mehr ergattern konnte, als ursprünglich gedacht, erinnern sich die Werber. Die Zeiten, in denen Fernsehwerbung zu jeder Zeit ein Selbstläufer war, sind vorbei, denn ab 1984 wurde das Angebot merklich größer und bunter.
Lesen Sie am Mittwoch im zweiten Teil der Reihe, mit welchen Strategien RTL und Sat.1 in ihren Anfangsjahren den Werbemarkt für sich erobern wollten.