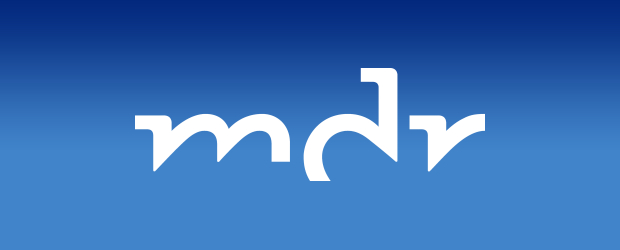Ob in Sachen Bedienkonzept wirklich die Gestensteuerung mit ihrem Herumgefuchtel der Weisheit letzter Schluss ist, sei einmal dahingestellt. So gut sie bereits jetzt schon funktionieren mag – zum Beispiel bei Microsofts Kinect: Einige Fragen sind noch offen. Denn anders als bei einer Touch-Oberfläche ist nicht alles intuitiv. Will ich auf etwas zeigen oder drücke ich einen virtuellen Knopf? Um diese Unterscheidung treffen zu können braucht es wiederum eindeutige Befehlsgesten, die erlernt werden müssen.
Wo es eine Bewegungssteuerung gibt, dort muss auch ein entsprechender Sensor oder eine Kamera sein. Das kommt einer weiteren Entwicklung zu pass, die ebenfalls die Wohnzimmer erobern soll. In dieser wurde bekannt, dass Intel eine Settop-Box an den Start zu bringen will, die per Gesichtserkennung in Erfahrung bringt, wer vor dem Fernseher sitzt. Nicht personalisiert, es gehe mehr um demographische Daten wie Alter, Geschlecht und so fort. Das Ziel: die maßgeschneiderte Auslieferung von Werbung.
Ein interessanter Ansatz – aber nicht wirklich neu. Firmen wie Quividi arbeiten an Lösungen, die genau diese Daten von Passanten liefern, die Werbetafeln im sogenannten Digital Out of Home-Bereich (DooH) betrachten. Das interaktive Plakat ist mehr als nur eine vage Vision. Auch dazu weiß Adam Greenfield bei Spiegel Online Interessantes zu sagen.
Das Internet der Dinge steht in den Startlöchern. Es geht immer weniger um die Frage, mit welcher Geste sich ein Programm umschalten und wie sich Twitter nun optimal in den Programmfluss einbinden lässt – als Laufband, oder doch lieber im Videotext? Denn mit der neuen Ausbaustufe des Netzes verändert sich unser Umgang mit Geräten grundlegend – und auch der Umgang der Geräte untereinander.
So wie das Fernsehen das Kino und das Kino das Theater verändert hat, so werden sich auch die neuen Erzählformen aus dem Netz und anderen digitalen Welten stilistisch auf das Fernsehen niederschlagen. Es geht aber nicht immer um die Frage, wie man einen Inhalt aus einem anderen Medium – zum Beispiel ein ausgereiftes Konsolenspiel – in ein TV-Format bringt.
Die Frage lautet häufig schlicht: Welche erzählerischen Elemente, welche visuellen Stilistiken lassen sich sinnvoll übertragen. Es geht nicht darum, auf dem Fernseher etwas anzubieten, das andere Medien viel besser können. Es geht eher darum, seine Zielgruppen abzuholen, die vielleicht andere Medieninteressen haben, als in die Jahre gekommene Magazinformate und behäbige Dokumentationen zu schauen. Es geht darum, ihnen einen Anker in ihrer Erfahrungswelt zu bieten.
Das erscheint mir als der Schlüssel zum Fernsehen der Zukunft (das nicht anders als das Fernsehen der Gegenwart unterhält, emotional bewegt, informiert, zerstreut und Erlebnisse schafft): Nicht der technischen Schnickschnack ist das Maß der Dinge – sondern die Art und Weise wie sich den Zielgruppen dadurch die Welt erschließt, wie er ihren Alltag organisiert und ihnen ein Bild von der Realität vermittelt – mit welchen Erzähllogiken, Metaphern, Ästhetiken und Interaktionen. Hat man das im Blick, sollte sich der Rest von Selbst ergeben. Es ist eigentlich ganz einfach.