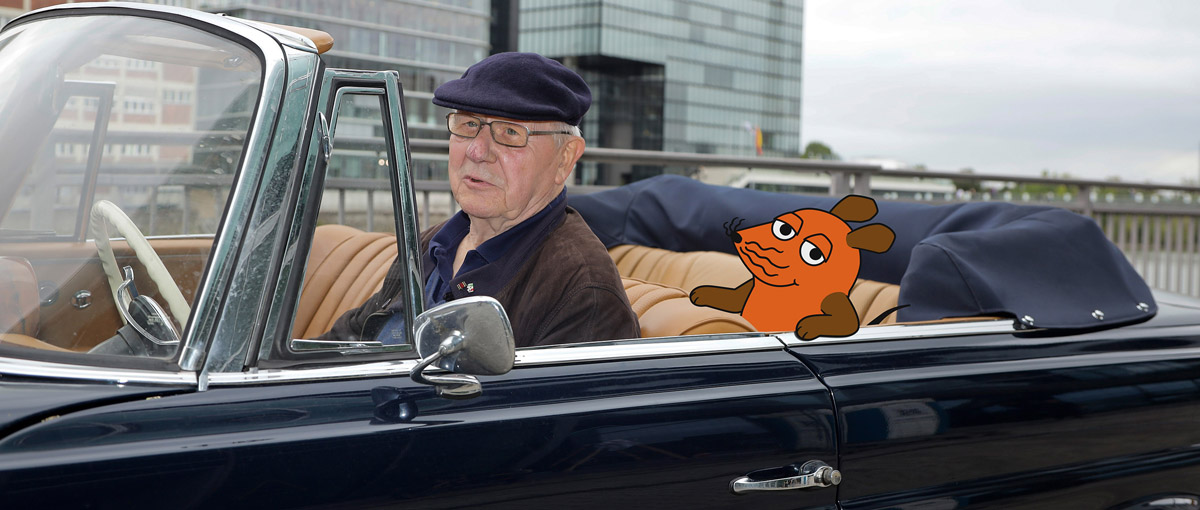Am Anfang einer langen Geschichte stand ein knapp betitelter Dokumentarfilm. „Ein Kinderzimmer 1979“ kam als kritischer Beitrag in der Konsumdiskussion der späten 70er Jahre daher. Die Autorin Ute Diehl suchte in einer kleinen Kölner Arbeiterfamilie „die Normalität, die Menschen funktionalisiert, um ein System in Gang zu halten.“ Der Film blieb ein Randbeitrag, ihre Protagonisten aber, Vater und Sohn Betriebsschlosser beim Kabelwerk Felten & Guilliaume, Mutter Sekretärin bei einem städtischen Personalrat, wurden zehn Jahre später berühmt. 1989 drehte Diehl den zweiten Dokumentarfilm mit der Familie, 1990 fand sich nach langen Bemühungen ein Sendeplatz für eine Doku-Serie. Sie brachten es schließlich auf über 100 Folgen in 17 Staffeln, und Diehl erhielt 1992 den Grimme-Preis. Die „Fussbroichs“ gehören heute, so schreibt der WDR, „zu Köln wie der Dom und die Hohenzollernbrücke.“
Am Anfang einer langen Geschichte stand ein knapp betitelter Dokumentarfilm. „Ein Kinderzimmer 1979“ kam als kritischer Beitrag in der Konsumdiskussion der späten 70er Jahre daher. Die Autorin Ute Diehl suchte in einer kleinen Kölner Arbeiterfamilie „die Normalität, die Menschen funktionalisiert, um ein System in Gang zu halten.“ Der Film blieb ein Randbeitrag, ihre Protagonisten aber, Vater und Sohn Betriebsschlosser beim Kabelwerk Felten & Guilliaume, Mutter Sekretärin bei einem städtischen Personalrat, wurden zehn Jahre später berühmt. 1989 drehte Diehl den zweiten Dokumentarfilm mit der Familie, 1990 fand sich nach langen Bemühungen ein Sendeplatz für eine Doku-Serie. Sie brachten es schließlich auf über 100 Folgen in 17 Staffeln, und Diehl erhielt 1992 den Grimme-Preis. Die „Fussbroichs“ gehören heute, so schreibt der WDR, „zu Köln wie der Dom und die Hohenzollernbrücke.“
Bis eine Fernsehserie über den unspektakulären Alltag in der Fabrik und der Familie Beachtung finden konnte, so Diehl, musste sich das Fernsehen zunächst verändern, einen Blick für das Lebensumfeld der einfachen Leute gewinnen. Heute ist der Unterhaltungswert des Normalo-Fernsehens unumstritten. Was nicht heißt, das Diehls feinfühlig komponierte Einblicke etwas mit den spaßigen Formaten der Dokusoap-Welle zu tun hätten. Ein Grundsatz: Vor Unterwäsche und Schlafzimmer wird Halt gemacht. Genau wie vor Geld – auf Wunsch der Protagonisten. Wichtiger ist Diehl, der gelernten Pädagogin, wie eine Familie von der Gesellschaft geprägt wird, die sie umgibt. In dieser Kontinuitätslinie steht auch ihre zweite Dokuserie, für die sie eine neue Familie gefunden hat. Wieder in Köln. Diesmal allerdings in der Keupstraße im Stadtteil Mülheim.

Diese Straße, die den Medienstandort Schanzenstraße mit seinen TV-Studios kreuzt und doch weit entfernt von ihnen scheint, steht beispielhaft für eine Gesellschaft in der Gesellschaft – als eines der Migrationszentren in Deutschland schlechthin. Wer nachmittags auf der Keupstraße flaniert, hört selten ein deutsches Wort, findet dafür Hochzeitsbedarf und Falafel in Hülle und Fülle, und in den schmucken Schaufenstern dazwischen „Baklavia“, Backwaren in allen Variationen. Hier hat Ute Diehl Familie Özdag gefunden, in die sie sich verliebt haben muss – denn eigentlich hielt sie es selbst nicht für möglich, dass auf die Fussbroichs noch einmal eine Familie folgen könnte, der sie sich und die sich ihr so nah und ausgiebig widmen würde. Die orientalische Feinbäckerei der Familie Özdag mitten im türkischsprachigen Köln, rechte Rheinseite, weckte noch einmal den Instinkt der kritischen Filmerin.
Die Geschichte der Özdags in Deutschland beginnt mit der Ankunft des Familienvaters Hasan, der in den späten 70er-Jahren mit einem Koffer ins Land kam. Es folgte eine gelungene Integrationsleistung, die Adaption deutschen Fleißes und wirtschaftlicher Erfolg. „So viele aufregende und unterschiedliche Menschen in einer Familie habe ich noch nicht erlebt“, sagt Ute Diehl. Hasan und seine Frau Aliye, die nur türkisch und arabisch spricht, ihre vier Söhne und drei Töchter, bilden die Besetzung. Eigentlich wollten sie nicht ins Fernsehen. „Meine Ausdauer und Ernsthaftigkeit haben sie überzeugt“, so Diehl.
 Die Özdags haben Fernsehpremiere: Der Laden mit der Zuckerbäckerei läuft prächtig. Viel Betrieb, und wohin man sieht, sind Frauen am Werk: Die Özdag-Töchter. Das Geschäft scheint in ihrer Hand zu sein. Sie selbst sehen sich als „Hühner“, selbstbewusst, eloquent und redselig räumen sie sofort mit der Annahme auf, in einer türkischen Familie säumten die Frauen nur ruhig und lächelnd den Rand des Geschehens. Die einzige, die das tut, ist Mutter Aliye. Sie sitzt am Kopfende und schweigt, gutmütig, die Schwestern sagen, sie sei in einer „Zwischenwelt“. Dann und wann schnappt sie ein deutsches Wort auf, ihren Enkelkindern bringt sie auf Türkisch und Arabisch immerhin das Zählen bei.
Die Özdags haben Fernsehpremiere: Der Laden mit der Zuckerbäckerei läuft prächtig. Viel Betrieb, und wohin man sieht, sind Frauen am Werk: Die Özdag-Töchter. Das Geschäft scheint in ihrer Hand zu sein. Sie selbst sehen sich als „Hühner“, selbstbewusst, eloquent und redselig räumen sie sofort mit der Annahme auf, in einer türkischen Familie säumten die Frauen nur ruhig und lächelnd den Rand des Geschehens. Die einzige, die das tut, ist Mutter Aliye. Sie sitzt am Kopfende und schweigt, gutmütig, die Schwestern sagen, sie sei in einer „Zwischenwelt“. Dann und wann schnappt sie ein deutsches Wort auf, ihren Enkelkindern bringt sie auf Türkisch und Arabisch immerhin das Zählen bei.
„Die Schwestern schmeißen den Laden“, geben auch Hasan Özdags Söhne zu, die nebenan in einem Restaurant über Frauen diskutieren. Im Vergleich zu ihren Schwestern wirken sie unsicher, haben sich aber längst mit ihrer Rolle abgefunden. Auch hier ist die Diskussion belebt: Wann soll man heiraten? Und woran erkennt man die richtige Frau? Kann man eine Beziehung mit einem Wagentest vergleichen? Immerhin, den Humor haben ihnen die Frauen nicht ausgetrieben. Und beim Lahmacun lässt es sich gut über sie lästern.
„Liebe ist der größte Stress“, die erste von sieben Folgen, zeigt Schwestern und Brüder in der Geschlechterdiskussion und setzt gleich ein Ausrufezeichen in Sachen Vielstimmigkeit. Sie zeigt erste Eindrücke von den Özdags als Großfamilie mit vielen Mitgliedern, vielen Meinungen, und einem festen Platz . Die Özdag-Söhne sprechen ein so glasklares Rheinisch, dass man gerne glaubt, dass auch sie zu Köln gehören. Wie der Dom und die Hohenzollernbrücke.